Solange die Klimawissenschaft nicht unwiderlegbare Beweise für die tatsächliche Wirkung des CO2 auf die Entwicklung der Erdtemperatur vorlegen kann, wird die politische Sichtweise des Klimawandels auf der Basis hypothetischer Modellannahmen die kontroverse Diskussion dieses Themas in der Öffentlichkeit nicht beigelegt werden können. Die zahlreichen von anerkannten Meteorologen und anderen Wissenschaftlern vorgelegten Statements über die nur geringe Wirkung des atmosphärischen CO2 blieben in der Politik bisher ohne Resonanz.
 Dr. Klaus Tägder
Dr. Klaus Tägder
Langzeitbetrieb der Kernkraftwerke stärkt Europas Energieversorgung
Das wissenschaftliche Beratungsgremium der European Nuclear Society, der High Scientific Council, plädiert in seinem Positionspapier nachdrücklich für den Langzeitbetrieb (LZB) der Kernkraftwerke in Europa. Der LZB sei entscheidend für Klimaschutz, Versorgungssicherheit und wettbewerbsfähige Strompreise und wirke drohenden Kapazitätslücken sowie steigenden Emissionen entgegen.
Fracking, die bislang politisch verpasste Chance als Beitrag zur Energieversorgung und zur CO2-Einsparung
Prof. Dr. Hans-Joachim Kümpel, ehem. Präsident der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR)
Das kalte Wetter hat Deutschlands Erdgas-Vorräte kräftig schrumpfen lassen, obwohl hiesige Energieunternehmen in den vergangenen Jahren in aller Welt massenhaft Flüssiggas (LNG) eingekauft haben. Dabei verfügt Deutschland eigentlich über eigene Erdgas-Ressourcen in großer Menge. Die müssen aber im Boden bleiben, aus politischen Gründen.
Lassen Sie mich Ihnen erzählen, wie es dazu kam. Aus nächster Nähe habe ich die Umstände miterlebt.
Hohe Kosten durch mangelnden Netzausbau
Der Anteil von Wind- und Solarstrom beträgt mittlerweile rund 60 Prozent an der Stromerzeugung. Aber der erforderliche Netzausbau hinkt dem Ausbau der Erneuerbaren hinterher. Er erfolgt von Anbeginn der Energiewende nicht synchron. Außerdem erfordern die neuen Netze Milliarden Euro, die letztlich die Verbraucher über die Stromrechnungen bezahlen.
„Der qualvolle Niedergang eine der europäischen Kernindustrien“
Wall Street Journal’s Newsletter ‚Klima & Energie‘ vom 29.1.2026 lese sich mit dieser Überschrift weniger wie ein Branchenbericht als vielmehr wie eine forensische Untersuchung einer industriellen Autopsie, schreibt Tilak Doshi [1]. Folgend ein paar Auszüge aus seinem Bericht, wie er über den wirtschaftlichen Aufstieg Deutschlands und über seine jetzige wirtschaftliche Krise urteilt:
Einst Europas beeindruckende Fertigungsmacht, herrscht Deutschland nun über den stetigen Abbau einer seiner grundlegendsten Industrien – der Chemie – unter dem kombinierten Gewicht von selbst zugefügter Energieknappheit, Klimamoralismus und geopolitischer Fehleinschätzung.
Polen: Überwältigende Zustimmung zur Kernenergie
Die Kernenergie genießt in Polen einen bemerkenswert starken Rückhalt in der Bevölkerung. Laut einer aktuellen, repräsentativen Umfrage sprechen sich über 90% der Polinnen und Polen für den Ausbau der Kernenergie aus. Die Regierung sieht darin ein starkes gesellschaftliches Mandat für die Kernenergie.
Der Bundesregierung wird ihr Klimaschutzgesetz „um die Ohren gehauen“
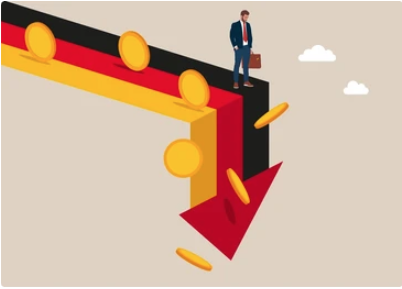
Quelle: Shutterstock
Das von der Bundesregierung beschlossene Klimaschutzprogramm 2023 bedarf ergänzender Maßnahmen, um das nationale Klimaziel einer Senkung der Treibhausgasemissionen im Vergleich zum Jahr 1990 um mindestens 65 Prozent bis 2030 zu erreichen. Dies hat das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG v. 29.1.2026, Az. 7 C 6.24) in Leipzig entschieden [1].
Die Bundesregierung hat auf der Grundlage des Bundes-Klimaschutzgesetzes (KSG) am 4. Oktober 2023 das Klimaschutzprogramm 2023 beschlossen, das die zur Erreichung des nationalen Klimaziels für 2030 beschlossenen Maßnahmen enthält. Der (Anm.: vom Bund finanziell geförderte) Kläger DUH begehrt die Ergänzung dieses Programms, weil er weitere Maßnahmen zur Erreichung dieses Ziels als erforderlich ansieht [1].
Weiterhin ungewöhnliche Schneefälle auf der Nordhalbkugel
Innerhalb von nur acht Tagen hat die Schneedecke auf der Nordhalbkugel um 4,34 Millionen km² zugenommen – der größte Zuwachs in der Neuzeit [1].
Die Wetterkapriolen halten offenbar noch an. Sollte Valentina Zharkova mit ihrer Prognose der Abkühlung in den nächsten Jahren Recht behalten und damit die von UN und IPCC seit Jahren verbreiteten Apokalypse von der Überhitzung des Planeten widerlegen?
Offshore-Windparks – Eine ernüchternde Betrachtung
Die zehn Nordsee- Anrainerstaaten planen den Aufbau einer gemeinsamen Offshore-Windenergiestrukur mit rund 300 GW Offshore-Windenergie inklusive Anbindungen und Netzanschlüssen in mehrere Länder. Davon rund 100 GW grenzüberschreitende Kooperationsprojekte [1].
Aktuell zeigt sich die Windbranche beim deutschen Ausbau pessimistisch: Verzögerungen beim Netzanschluss der Anlagen sowie das Ausbleiben von Geboten in der Ausschreibungsrunde im August 2025 hätten zur Folge, dass das Ausbauziel in Höhe von 30 GW bis 2030 verfehlt werden. Bis dahin sei lediglich ein Zubau von 20 GW zu erwarten.
RWI plädiert für Verschiebung der Klimaschutzziele
Nach Ansicht des Essener Institutes RWI gebe es gute Gründe, die Treibhausgas-Neutralität erst für das Jahr 2050 anzustreben [1]. Deutschland soll laut Klimaschutzgesetz bereits im Jahr 2045 klimaneutral werden und somit fünf Jahre früher als die Europäische Union (EU). Im Verbund mit anderen Wirtschaftsverbänden forderte auch der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) im Jahr 2025, das deutsche Klimaneutralitätsziel von 2045 auf 2050 zu verschieben, denn Teile der Industrie sehen im schärferen nationalen Ziel einen Nachteil für hiesige Unternehmen. Ebenso die FDP forderte in ihrem Wahlprogramm zur Bundestagswahl 2025, das Zieljahr 2045 an das EU-Zieljahr 2050 anzugleichen. Diese Forderung geht auf das vom ehemaligen FDP-Vorsitzenden Christian Lindner (2024) verfasste Papier zur „Wirtschaftswende Deutschland“ zurück.
