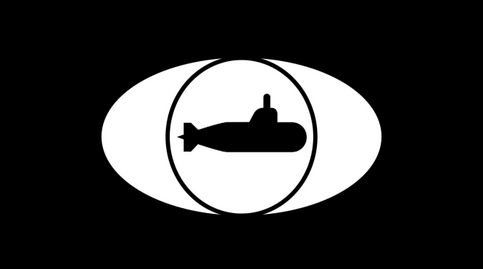Die Windindustrie hat faktisch zugegeben, dass sie die britische Öffentlichkeit über die Kosten der Energiewende getäuscht hat. Dies geht aus einer Pressemitteilung von Net Zero Watch vom 26.10.2023 hervor, die sich auf Telegaph [1] bezieht. RWE Renewables habe der Regierung gerade mitgeteilt, dass sie ihren Strompreis um 70 Prozent erhöhen muss, wenn weitere Windparks gebaut werden sollen.
PM Rishi Sunak hatte bereits zugegeben, dass es eine langfristige Täuschung der britischen Öffentlichkeit gegeben habe. Die Forderung von RWE nach mehr Subventionen bestätigt dies. Der „Green Blob“ lügt seit Jahren über die Kosten der erneuerbaren Energien. Die Wahrheit ist, dass Windkraft teuer ist und immer teurer wird. Die Energiewende ist ein Übergang in die Armut, aber nur wenige westliche Minister scheinen den Mut zu haben, das zu sagen, heißt es in der Pressemitteilung.
Seit vielen Jahren behauptet die Windindustrie, dass sie einen dramatischen Kostenrückgang erlebt habe, und unterzeichnet „Contracts for Difference“ (CfDs), um Strom zu außergewöhnlich niedrigen Preisen zu liefern. Später stellte sich heraus, dass es sich um einen Betrug handelte, bei dem sich Windparks weigerten, CfD-Verträge zu aktivieren, und dadurch Hunderte von Millionen an Zufallsgewinnen erzielten. Die Entscheidung der Regierung, dieses Schlupfloch zu schließen, führte zum völligen Scheitern der letzten CfD-Auktion.
Die Forderung von RWE nach einer drastischen Erhöhung der Subventionen zeigt, dass die Industrie nun gezwungen ist, Angebote abzugeben, die die tatsächlichen Kosten von Windparks besser erfassen.
[1] https://www.telegraph.co.uk/business/2023/10/25/electricity-prices-rise-70pc-pay-wind-farms-energy/?mc_cid=a637fae39d